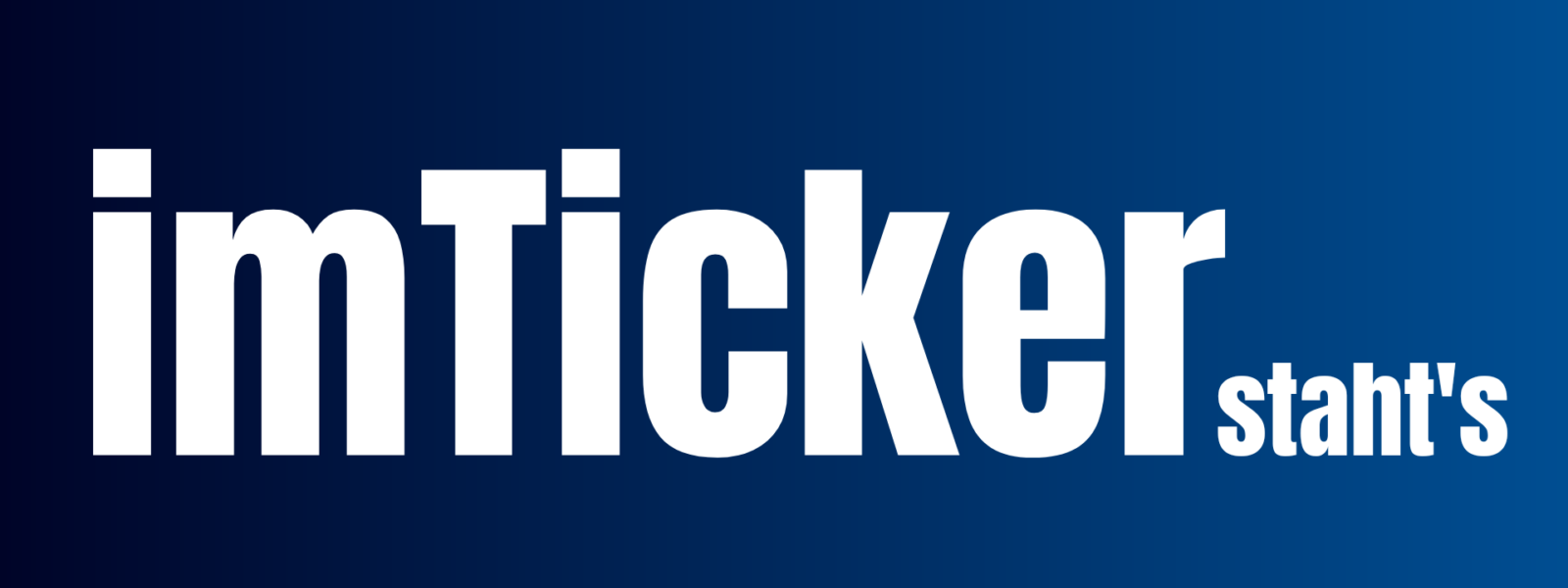Die Diskussion um Tempo 30 spaltet die Schweiz – zwischen Verkehrsberuhigung, Sicherheit und politischem Zündstoff.
Kaum ein Verkehrsthema bewegt Schweizer Städte derzeit so stark wie die Einführung von Tempo 30. Ob in Zürich (ZH), Basel (BS) oder Bern (BE) – der Ruf nach leiseren, sichereren Strassen trifft auf den Widerstand von Automobilverbänden, Gewerbe und Teilen der Politik. Die hitzige Debatte hat längst nationale Dimensionen angenommen. Während die einen von einem Fortschritt in Sachen Lebensqualität sprechen, warnen andere vor einer „Verkehrsverhinderungsstrategie“.
Was steckt wirklich hinter dem Trend zur flächendeckenden Temporeduktion, und wo liegen die grössten Konfliktlinien?
Tempo 30 ist kein neues Konzept. Seit den 1980er-Jahren werden in der Schweiz Zonen mit reduzierter Geschwindigkeit eingeführt – ursprünglich vor allem in Wohnquartieren. Doch inzwischen weiten viele Städte das Konzept auch auf Hauptverkehrsachsen aus.
Die Argumente der Befürworter: Weniger Lärm, mehr Sicherheit, bessere Luft. Die Gegner kontern: längere Fahrzeiten, unfaire Benachteiligung des Autoverkehrs, wirtschaftliche Einbussen fürs lokale Gewerbe.
Der Bund überlässt die Umsetzung grundsätzlich den Kantonen und Gemeinden, doch mit jeder neuen Tempobeschränkung wächst der politische Druck auf Bundesebene – insbesondere durch Vorstösse der SVP und FDP, die eine „Entideologisierung“ der Verkehrspolitik fordern.
In Zürich (ZH) wurde Anfang 2024 ein neuer Abschnitt der Innenstadt auf Tempo 30 umgestellt – auch tagsüber auf Hauptstrassen. Die Stadtregierung spricht von einem „wichtigen Schritt zu mehr Lebensqualität“. Die Reaktionen: gemischt. Während Anwohnende erleichtert sind, sieht die Auto-Lobby rot. Die Automobilverbände prüfen rechtliche Schritte.
In Lausanne (VD) wiederum wird derzeit ein flächendeckendes Netz an Tempo-30-Zonen diskutiert. Basel (BS) führt Pilotversuche durch. Auch kleinere Städte wie Thun (BE) oder Winterthur (ZH) experimentieren mit Modellen auf Hauptachsen.
Zitat aus einer Mitteilung der Stadt Zürich (ZH):
„Die Temporeduktion dient dem Schutz der Bevölkerung und entspricht der städtischen Lärmschutzverordnung.“
Laut einer ETH-Studie sinkt das Unfallrisiko bei Tempo 30 um rund 40 %, die Zahl tödlicher Verkehrsunfälle gar um 60 %. Zudem ist die Lärmbelastung bei Tempo 30 bis zu 3 Dezibel geringer – was einer Halbierung des empfundenen Lärms entspricht.
Gleichzeitig zeigen Mobilitätsanalysen, dass der Zeitverlust im innerstädtischen Verkehr meist unter einer Minute liegt – ein Punkt, den Gegner oft unterschätzen.
Interessant: In Städten wie Grenoble (Frankreich) oder Brüssel gilt bereits flächendeckend Tempo 30 – mit positiven Rückmeldungen aus Bevölkerung und Behörden.
Anwohnerin Maria L.* aus Zürich (ZH) sagt:
„Seit der Einführung von Tempo 30 schlafen wir besser – es ist, als wäre der Verkehr ein Stück weiter weggerückt.“
Auch Velofahrer und Familien profitieren: Kinder können laut Beobachtungen der Polizei sicherer über die Strassen.
Auf der anderen Seite: Ein Taxiunternehmer kritisiert, dass er pro Schicht weniger Aufträge fahren kann.
„Wir stehen mehr, als dass wir fahren. Und am Ende bezahlen das die Kunden.“
Tempo 30 ist weit mehr als eine Frage der Geschwindigkeit – es geht um das künftige Gesicht unserer Städte. Die Debatte zeigt exemplarisch, wie eng Lebensqualität, Umweltschutz und Mobilität miteinander verflochten sind.
Ob sich das Modell flächendeckend durchsetzt, hängt vom politischen Willen, der Akzeptanz in der Bevölkerung und der konkreten Umsetzung ab.
Verpasse keine News mehr! Aktiviere unseren kostenlosen Whatsapp-Kanal