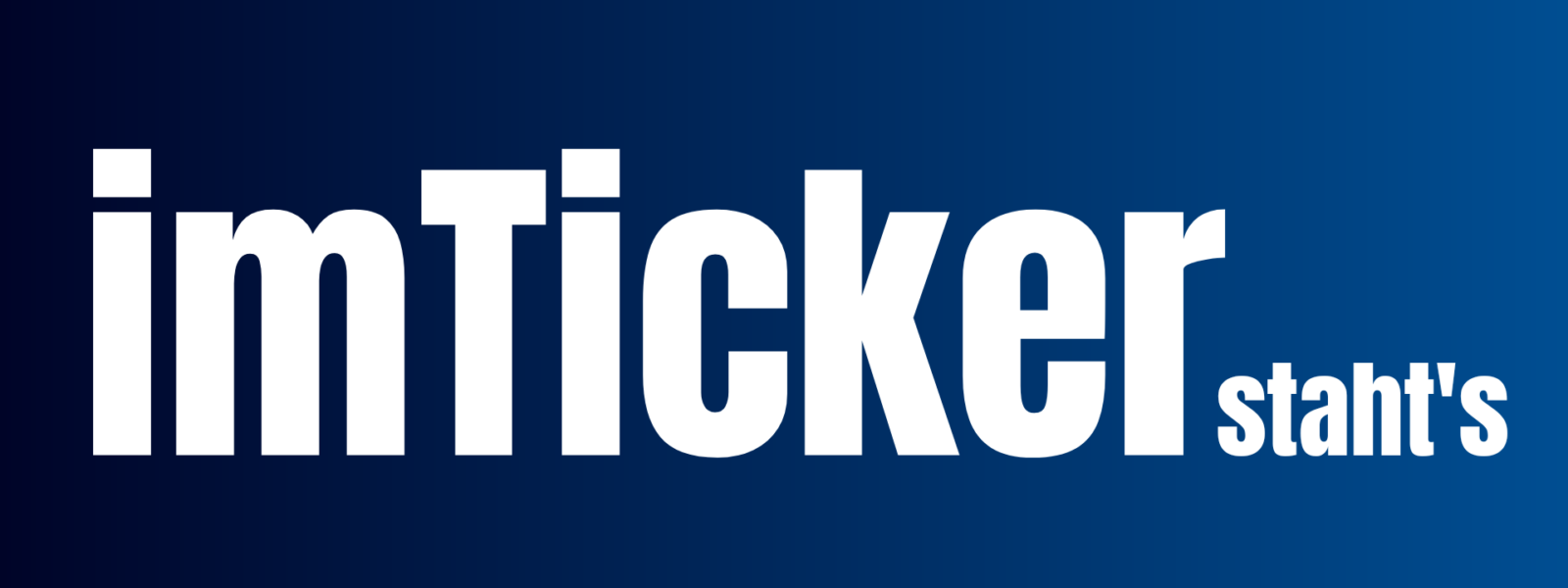Obwohl Strafen hart sind, ignorieren viele das Risiko – was steckt dahinter?
Rasen gilt als eines der gefährlichsten Verkehrsdelikte – mit oft tödlichen Folgen. Und doch scheinen viele Temposünder keine Angst vor Radarkontrollen oder Bussen zu haben. Warum ist das so? Ist es Gleichgültigkeit, Übermut oder ein gesellschaftliches Problem? Und wie wirksam sind die Schweizer Strafen überhaupt?
Raserei gehört zu den Hauptursachen für schwere Verkehrsunfälle in der Schweiz. Laut bfu – Beratungsstelle für Unfallverhütung ist überhöhte Geschwindigkeit bei fast jedem dritten tödlichen Unfall im Spiel. Trotzdem nehmen viele Autofahrer hohe Tempi in Kauf – selbst dort, wo sie wissen, dass Blitzer stehen könnten.
In der Schweiz gelten teils harte Regeln: Wer innerorts mehr als 50 km/h zu schnell fährt, verliert den Führerausweis automatisch – und riskiert sogar Freiheitsstrafen. Das sogenannte „Raserartikel“ im Strafrecht (Art. 90 Abs. 3 SVG) sieht seit 2013 eine Mindestfreiheitsstrafe von einem Jahr vor – theoretisch.
Was bringt Menschen dazu, bewusst Regeln zu ignorieren, die sie kennen? Die Antwort liegt oft in der Psychologie: Viele überschätzen ihre eigenen Fähigkeiten und unterschätzen Risiken – ein Phänomen, das als Optimismusverzerrung bekannt ist. Der Gedanke: „Mir passiert schon nichts.“
Zudem wirken Gewöhnung und Routine enthemmend. Wer jahrelang mit 10–20 km/h zu viel durchkommt, verharmlost die Konsequenzen. Einige empfinden sogar einen Kick durch Geschwindigkeit – ähnlich wie bei einem Adrenalinschub im Sport. Das Problem: Solche Verhaltensmuster sind schwer zu durchbrechen, vor allem wenn sie mit einem Gefühl von Unantastbarkeit einhergehen.
Für Angehörige von Verkehrsopfern ist das schwer zu ertragen. Organisationen wie RoadCross Schweiz fordern härtere Sanktionen und mehr Kontrollen – aber auch mehr Prävention. Denn Respekt auf der Strasse beginnt im Kopf: Wer andere gefährdet, verletzt mehr als Regeln – er gefährdet Leben.
Der gesellschaftliche Umgang mit Rasern ist ambivalent: Einerseits gibt es Empörung, andererseits auch eine gewisse Toleranz oder Faszination – insbesondere bei teuren Autos oder Prominenten. Doch ein zerstörtes Leben lässt sich nicht zurückdrehen. Ein Vater, dessen Sohn durch einen Raser starb, sagte: „Er fuhr, als gehörte die Strasse ihm. Jetzt haben wir nur noch ein Grab.“
Verpasse keine News mehr! Aktiviere unseren kostenlosen Whatsapp-Kanal