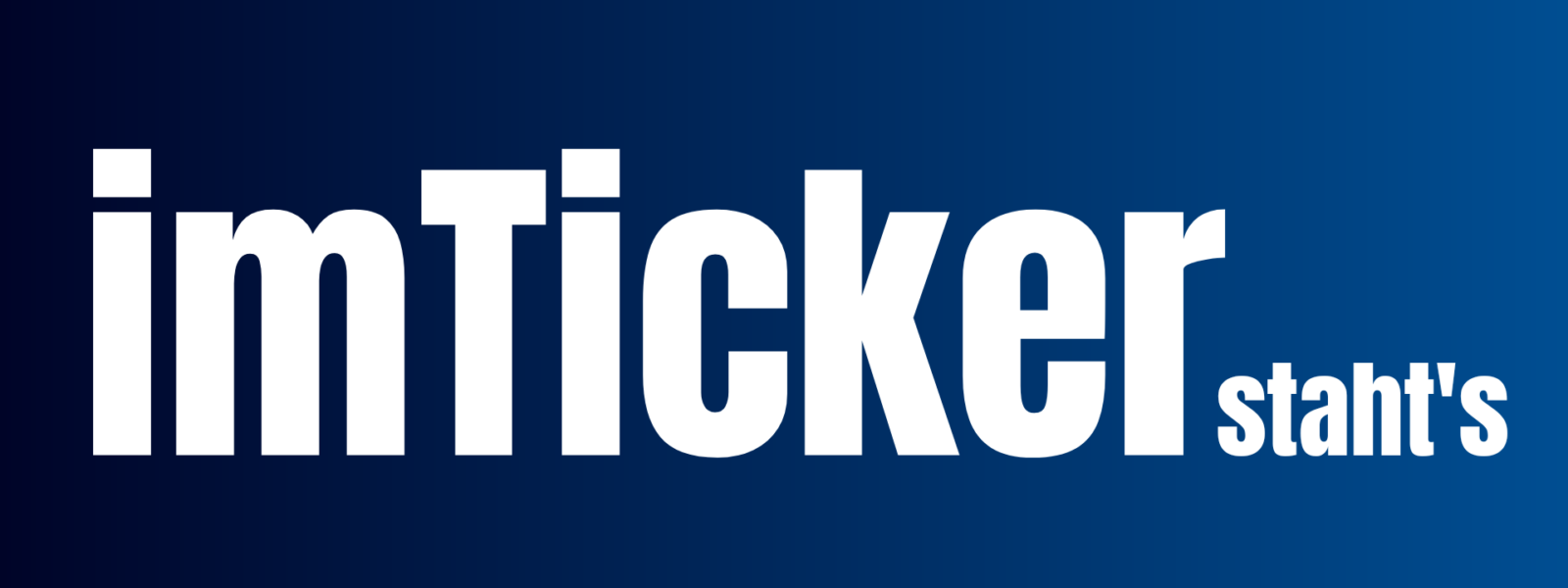Der Schweizer Mittelstand gerät unter Druck – trotz Vollzeitjob reicht das Geld oft kaum zum Leben.
Steigende Mieten, höhere Krankenkassenprämien und explodierende Lebensmittelpreise – in der Schweiz wächst eine neue soziale Realität: Erwerbstätige Menschen geraten zunehmend in finanzielle Not. Die klassische Vorstellung, dass Arbeit vor Armut schützt, scheint zu bröckeln. Der Mittelstand steht am Rand des wirtschaftlichen Abgrunds.
Arbeiten und trotzdem arm: Ein wachsendes Phänomen
In der Schweiz gelten laut Bundesamt für Statistik rund 8,7 % der Bevölkerung als einkommensarm – darunter viele mit einer festen Anstellung. Besonders betroffen: Alleinerziehende, junge Familien, Menschen mit Teilzeitstellen und solche mit mittleren Einkommen, die knapp über der Armutsgrenze liegen. Diese Gruppe kämpft täglich mit einem paradoxen Zustand: Arbeit ja, aber kein finanzieller Spielraum.
Hauptgründe für den Druck auf den Mittelstand
Mehrere Faktoren setzen dem Mittelstand aktuell besonders zu:
- Lebenshaltungskosten: Die Schweiz zählt zu den teuersten Ländern Europas. Wohnkosten verschlingen teils über 35 % des Haushaltseinkommens, etwa in Städten wie Zürich (ZH) oder Genf (GE).
- Krankenkassenprämien: Seit Jahren steigen die Prämien überdurchschnittlich – für viele Haushalte bedeutet das eine monatliche Mehrbelastung von mehreren hundert Franken.
- Inflation: Auch wenn sie moderat ausfällt, schlagen selbst kleine Preissteigerungen bei Energie, Lebensmitteln oder Verkehr deutlich auf das Budget durch.
Wenn das Budget nicht mehr reicht: Erste Anzeichen
Viele Betroffene merken zuerst, dass am Monatsende nichts mehr übrig bleibt:
- Kein Geld für Unerwartetes (Zahnarzt, Reparaturen)
- Einsparungen bei gesunder Ernährung
- Verzicht auf Ferien oder Freizeitaktivitäten
- Schulden für Alltägliches
So entsteht eine neue Form von Armut – oft versteckt, schambesetzt und nicht sichtbar in Statistiken über Sozialhilfe.
Psychosoziale Folgen: Armut belastet auch die Seele
Die permanente finanzielle Unsicherheit führt zu Angst, Scham und Stress. Zahlreiche Studien zeigen: Finanzielle Not wirkt sich negativ auf das Wohlbefinden aus, erhöht das Risiko für Depressionen und wirkt sich sogar auf die körperliche Gesundheit aus.
Wer hilft, wenn Arbeit nicht mehr reicht?
Organisationen wie Caritas Schweiz (LU) oder Tischlein deck dich (ZH) berichten von steigenden Anfragen von Erwerbstätigen. Auch Gemeinden registrieren mehr Menschen, die Unterstützung beantragen – obwohl sie einer Beschäftigung nachgehen.
Einige Kantone, wie etwa Bern (BE) oder Waadt (VD), prüfen aktuell gezielte Entlastungen, etwa durch Prämienverbilligungen oder Unterstützungsfonds für Working Poor. Doch strukturelle Lösungen stehen noch aus.
Mögliche Auswege: Was die Politik tun könnte
- Prämiendeckel bei Krankenkassen: Entlastung für Haushalte mit mittlerem Einkommen
- Förderung von bezahlbarem Wohnraum: Besonders in städtischen Regionen dringend nötig
- Bessere Vereinbarkeit von Beruf und Familie: Mehr Kita-Plätze und flexible Arbeitsmodelle
- Anpassung von Mindestlöhnen oder gezielte Lohnzuschüsse
Ein Blick ins Ausland zeigt: In Ländern wie Frankreich gibt es bereits kombinierte Lösungen mit staatlichen Zuschüssen für Geringverdiener.
Ein systemisches Problem braucht systemische Lösungen
Die neue Armut zeigt, dass wirtschaftlicher Druck nicht nur Randgruppen betrifft. Sie betrifft die Mitte – und damit das Rückgrat der Gesellschaft. Wenn diese tragende Schicht wankt, ist Handeln gefragt: von Politik, Wirtschaft und Gesellschaft gemeinsam.
Verpasse keine News mehr! Aktiviere unseren kostenlosen Whatsapp-Kanal