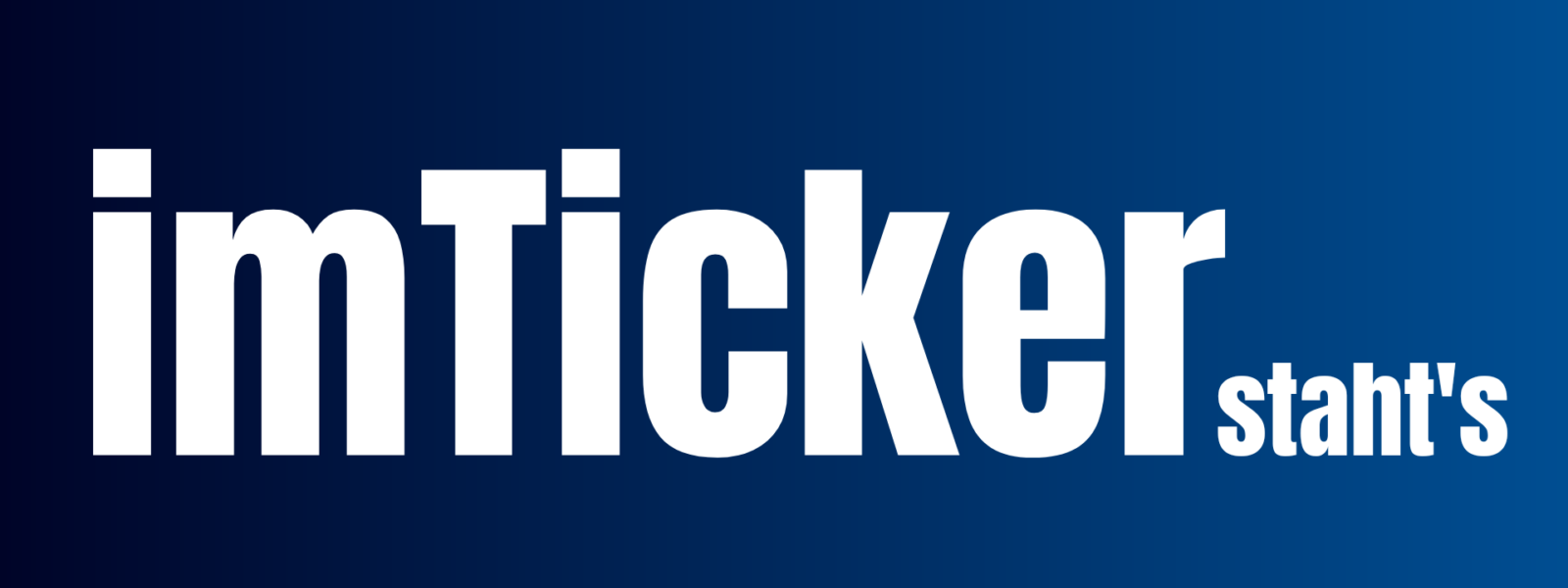Neue Technologie soll für mehr Disziplin im Nationalrat sorgen
Im Nationalratssaal herrscht oft ein Geräuschpegel, der einer Bahnhofshalle gleicht – selbst während Debatten. Immer wieder klagen Ratspräsident:innen über ungenügende Disziplin und respektlosen Lärm. Jetzt soll ein innovatives System Abhilfe schaffen: Der sogenannte «Lärmblitzer» registriert übermässige Lautstärke im Plenum – und markiert diese visuell. Der Einsatz dieser Technologie löst Diskussionen aus: Ist das ein längst überfälliger Schritt zur Ordnung – oder ein fragwürdiger Eingriff in die parlamentarische Freiheit?
Im Folgenden klären wir, wie das System funktioniert, warum es eingeführt wurde, was es für die Debattenkultur bedeutet und wie Politiker:innen darauf reagieren.
Die Disziplin im Nationalratssaal war schon seit Jahrzehnten ein Thema. Immer wieder beklagten sich Ratsleitende über das «ständige Geschnatter» und die fehlende Aufmerksamkeit während Voten. Besonders während medienwirksamer Abstimmungen oder hitziger Debatten sei der Geräuschpegel oft unerträglich.
Der Nationalrat als grosse Kammer des Parlaments tagt im Bundeshaus in Bern. 200 Sitze, politische Vielfalt und oft volle Tagesordnungen sorgen für ein dynamisches, aber auch chaotisches Arbeitsklima. Frühere Versuche mit Appellen oder Mikrofonabschaltungen hatten wenig Wirkung – weshalb nun technologische Disziplinierung ins Spiel kommt.
Das neue System basiert auf Mikrofonen und Geräuschsensoren im Saal. Sobald eine vordefinierte Lautstärkeschwelle überschritten wird, leuchtet eine LED-Anzeige rot auf – als «Blitz» gegen die Lärmverursacher:innen. Ziel ist es, Gespräche während Voten sichtbar zu rügen, ohne die Debatte technisch zu unterbrechen.
Eingeführt wurde das System in der Frühjahrssession 2025. Laut Parlamentsdienste handelt es sich um eine Testphase. Erste Rückmeldungen aus dem Rat sind gemischt: Während die einen das System als «hilfreiche Mahnung» empfinden, sprechen andere von «pädagogischer Überwachung».
Laut einer internen Studie der Parlamentsdienste lag der durchschnittliche Geräuschpegel während Sitzungen oft bei über 70 Dezibel – vergleichbar mit einer stark befahrenen Strasse. In einer 2023 durchgeführten Umfrage unter Ratsmitgliedern gaben 64 % an, sich durch Gespräche während Reden gestört zu fühlen.
Der Begriff «Lärmblitzer» stammt ursprünglich aus der Verkehrspolitik – dort messen ähnliche Geräte die Lautstärke getunter Fahrzeuge. Die Adaption für das Parlament zeigt, wie technische Innovationen in neue gesellschaftliche Kontexte übertragen werden.
«Endlich hört man wieder, wer spricht», sagt eine SP-Abgeordnete, die namentlich nicht genannt werden will. «Das gibt den Reden mehr Gewicht – und zwingt zum Zuhören.» Ein SVP-Parlamentarier hingegen mokiert sich über das System: «Wir sind doch keine Schüler:innen!»
Auch aus der Bevölkerung kommen Reaktionen: Auf Social Media wird das Thema unter dem Hashtag #Lärmblitzer kontrovers diskutiert – von Zustimmung über Satire bis hin zu Ablehnung. Das Projekt trifft einen Nerv, denn es geht nicht nur um Disziplin – sondern auch um Respekt und demokratische Kultur.
Mit dem «Lärmblitzer» zieht neue Technologie in die älteste politische Institution der Schweiz ein. Ob damit die Disziplin nachhaltig verbessert wird, bleibt abzuwarten. Klar ist: Die Idee sorgt für Gesprächsstoff – paradoxerweise gerade dadurch, dass sie das Gespräch eindämmen will. Vielleicht hilft sie aber auch, wieder mehr dem zuzuhören, worum es eigentlich geht: den politischen Inhalten.
Verpasse keine News mehr! Aktiviere unseren kostenlosen Whatsapp-Kanal