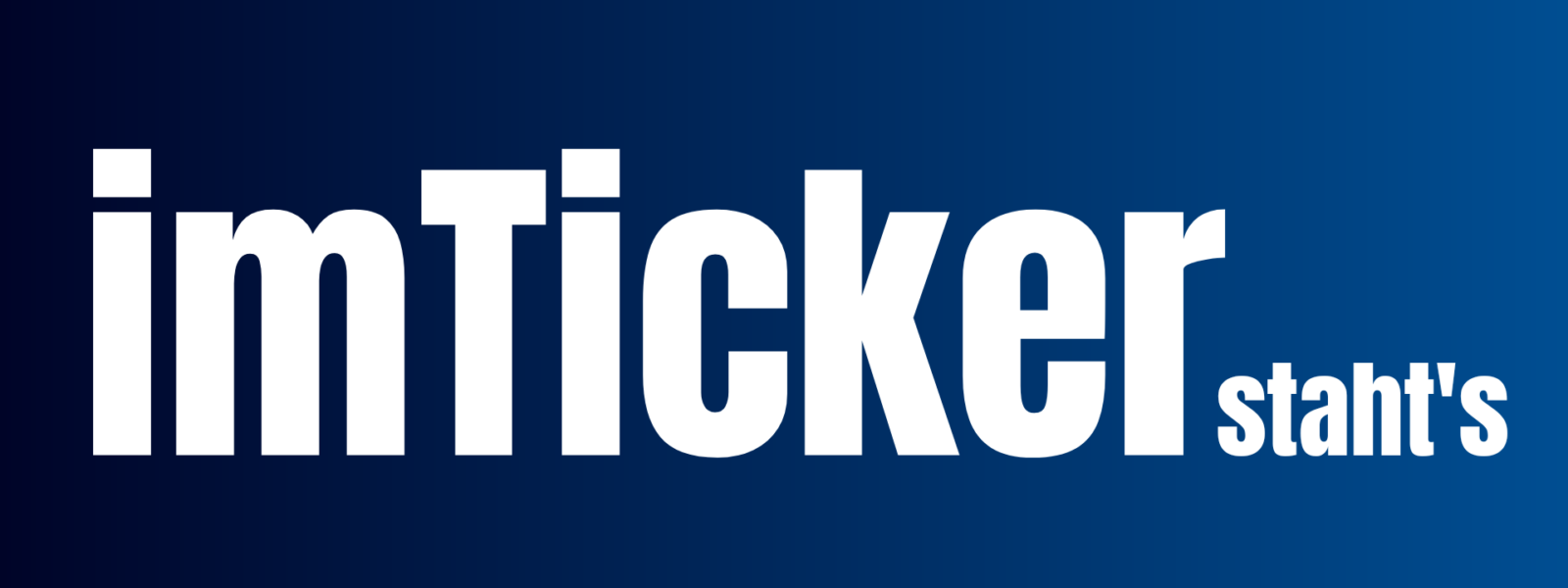Winter 2024/25 brachte Schneemangel und eine kritische Altschneesituation
Der Winter 2024/25 zählt zu den zehn mildesten seit Messbeginn 1864. Charakteristisch war die ausgeprägte Schneearmut in den Schweizer Alpen, besonders im Osten. Hauptursache dafür waren sehr geringe Niederschläge zwischen November 2024 und April 2025. Auffällig war, dass trotz schneereicher Perioden in hohen Lagen die Schneedecke insgesamt schwach blieb – ein Altschneeproblem, das die Lawinengefahr vielerorts bestimmte, wie das WSL-Institut für Schnee- und Lawinenforschung Slf.ch berichtet.
Ein zögerlicher Start in den Winter
Im Herbst 2024 blieb der erste Wintereinbruch aus, Schnee fiel nur im Hochgebirge über 3000 m. Erst Mitte November sorgte eine West- und Nordströmung für intensiven Schneefall bis in tiefere Lagen. Dennoch blieb die frühe Schneelage labil: Auf den warmen Böden bildeten sich verbreitet Gleitschneelawinen, und schwache Schichten in der Schneedecke bereiteten später massive Probleme.
Weihnachten brachte Neuschnee – und Lawinengefahr
Im Dezember fielen erneut ergiebige Schneemengen, besonders vom 21. bis 24. Dezember. Der frische Schnee überdeckte die fragilen Schichten, was die Lawinengefahr massiv ansteigen liess. Besonders entlang des nördlichen Alpenkamms und im Gotthardgebiet (UR/TI) wurden grossflächige Lawinenabgänge verzeichnet. Wintersportler lösten über die Feiertage viele Lawinen aus, oft mit mittlerem oder grossem Ausmass.
Januar und Februar: Wechselhafte Bedingungen, viele Lawinen
Der Januar startete stürmisch: Triebschnee bildete neue Schwachschichten, besonders am 18. Januar. Gegen Ende Januar brachte eine Südstaulage extreme Schneefälle im Süden (TI) und Westen (VS/VD). Trotz hoher Lawinengefahr blieben die Sachschäden gering. Ab Februar beruhigte sich die Situation, mit häufig mässiger Lawinengefahr und günstigen Bedingungen für Skitouren.
März und April: Südstaulagen und ein Winterfinale
Im März kehrte der Winter kurzzeitig zurück: Besonders im Tessin und südlichen Graubünden fielen grosse Neuschneemengen. Die Lawinengefahr stieg erneut auf Stufe 4. Ab Ende März fiel selbst im schneearmen Nordosten (SG/GL) nochmals bis zu einem halben Meter Schnee. Nordhänge blieben jedoch anfällig für Lawinenauslösungen aufgrund eines weiterhin bestehenden Altschneeproblems.
Weniger Lawinentote trotz mehr Personenlawinen
Bis zum 14. April 2025 verzeichnete das SLF 156 Personenlawinen mit 216 erfassten Personen – leicht über dem langjährigen Schnitt. Dennoch starben nur 10 Menschen, deutlich weniger als im 20-Jahres-Durchschnitt von 19 Todesopfern. Effiziente Kameradenrettungen und das Ausbleiben grosser Massenunfälle trugen zu diesem positiven Ergebnis bei.
Klimatische Einordnung: Trockenster Winter seit Jahrzehnten
Auf 2000 m lag Mitte April nur 36 % der üblichen Schneemenge. Besonders Nord- und Mittelbünden (GR) verzeichneten Rekordtiefs. Der Wasserstand von Flüssen wie dem Bodensee (TG/SG) war so niedrig wie zuletzt 1972. Für den Wintertourismus war es dennoch ein teils erfreuliches Jahr: frühe Schneefälle und viele Sonnenstunden während der Festtage sorgten für gute Bedingungen auf den Pisten.
Ein aussergewöhnlicher Winter
Der Winter 2024/25 bleibt als besonders schneearm und mild in Erinnerung. Während das Altschneeproblem grosse Lawinengefahren verursachte, sorgte effizientes Verhalten der Wintersportler für vergleichsweise wenig Todesopfer. Eine endgültige Bilanz wird der Winterbericht im Herbst 2025 ziehen.
Verpasse keine News mehr! Aktiviere unseren kostenlosen Whatsapp-Kanal