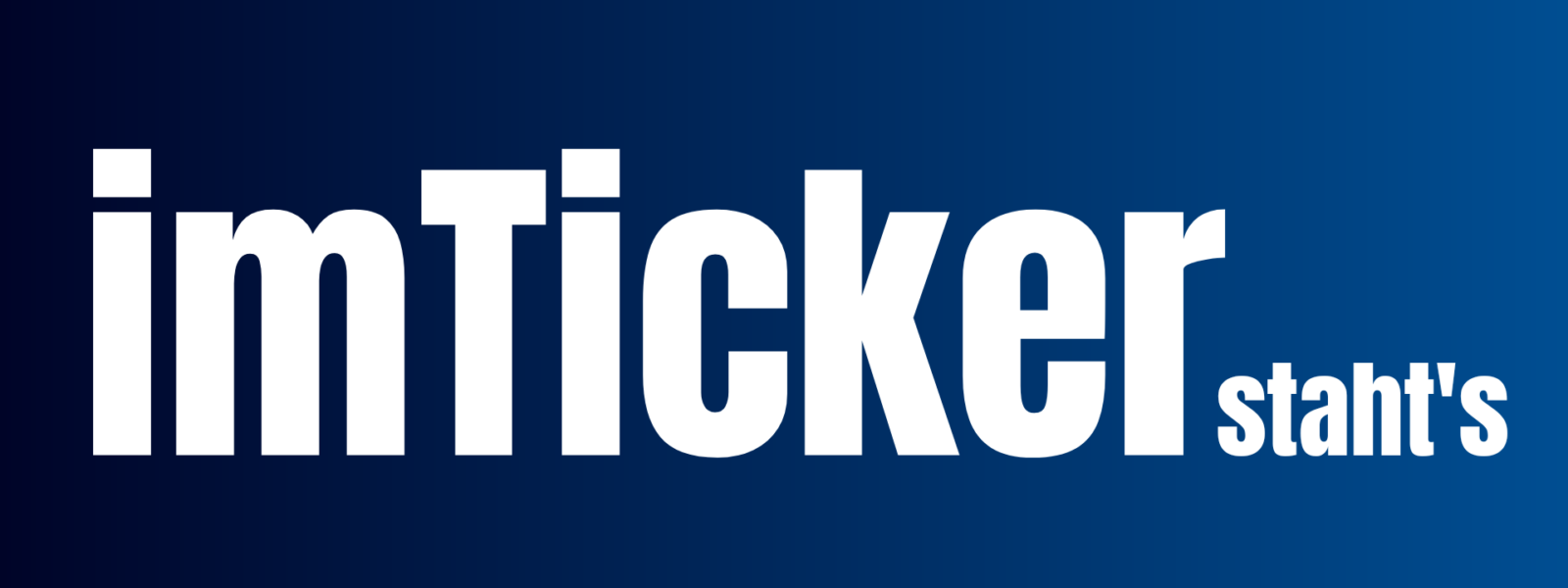Welche Hunde setzt die Polizei ein – und warum sind sie so wichtig?
Polizeihunde sind für die Polizei unverzichtbare Helfer. Doch welche Hunderassen kommen überhaupt zum Einsatz – und wofür? Die Geschichte der Diensthunde zeigt: Es steckt mehr dahinter als nur Spürsinn.
Schäferhund & Co.: Die bekanntesten Polizeihunde-Rassen
Die bekanntesten Polizeihunde sind wohl der Deutsche Schäferhund und der Belgische Malinois. Beide Rassen vereinen Schnelligkeit, Intelligenz und eine starke Bindung zum Hundeführer – ideale Voraussetzungen für Polizeieinsätze. Aber auch Rassen wie Labrador Retriever oder Springer Spaniel kommen vermehrt als Spürhunde zum Einsatz, beispielsweise bei der Drogen- oder Sprengstoffsuche.
Vielseitige Aufgaben: Vom Spürhund bis zum Schutzhund
Polizeihunde werden speziell ausgebildet – je nach Aufgabe. Dazu zählen unter anderem:
- Schutzhunde: schützen Einsatzkräfte und helfen bei Festnahmen
- Fährtenhunde: verfolgen Spuren von vermissten Personen oder flüchtigen Tätern
- Sprengstoff- und Drogenspürhunde: entdecken gefährliche Stoffe in Gepäck, Gebäuden oder Fahrzeugen
- Leichenspürhunde: finden verstorbene Personen – oft bei Katastropheneinsätzen
Diese Spezialisierungen setzen eine intensive Ausbildung voraus, die oft über Monate, manchmal Jahre dauert.
Warum gerade diese Rassen? Kriterien für Polizeihunde
Nicht jeder Hund eignet sich für den Polizeidienst. Die wichtigsten Kriterien sind:
- hohe Belastbarkeit
- ausgeprägter Spieltrieb (wichtig für die Ausbildung)
- starke Nerven
- Lernfreude und Führigkeit
- gute körperliche Fitness
Rassen wie der Malinois oder der Schäferhund bringen all das mit – und lassen sich zugleich gut sozialisieren.
Ein Blick zurück: Die Geschichte der Polizeihunde
Schon im 19. Jahrhundert setzte die Polizei Hunde ein – zuerst als reine Wachhunde. Ab 1896 bildete man in Belgien (BEL) die ersten Polizeihundestaffeln aus, bald darauf auch in Deutschland (D). In der Schweiz (CH) waren Diensthunde spätestens ab den 1920er-Jahren fester Bestandteil der Polizeiarbeit. Seither wurden die Aufgaben stetig erweitert – auch dank moderner Trainingsmethoden.
Tierschutz und Ruhestand: Was passiert nach dem Dienst?
Polizeihunde gehen meist im Alter von acht bis zehn Jahren in „Rente“. Viele leben danach weiter bei ihrem Hundeführer oder finden ein neues Zuhause. Während ihrer Dienstzeit gelten sie rechtlich als „Polizeimitarbeiter“ – mit entsprechendem Schutzstatus, auch was Angriffe betrifft.
Fazit: Unverzichtbare Partner auf vier Pfoten
Polizeihunde leisten jeden Tag Erstaunliches – sei es bei der Spurensuche, in Menschenmengen oder bei gefährlichen Einsätzen. Ihre Vielseitigkeit, Loyalität und Ausdauer machen sie zu unverzichtbaren Partnern im Polizeidienst. Ein respektvoller Umgang und eine artgerechte Ausbildung sind dabei ebenso wichtig wie die Anerkennung ihrer Leistung.
Verpasse keine News mehr! Aktiviere unseren kostenlosen Whatsapp-Kanal