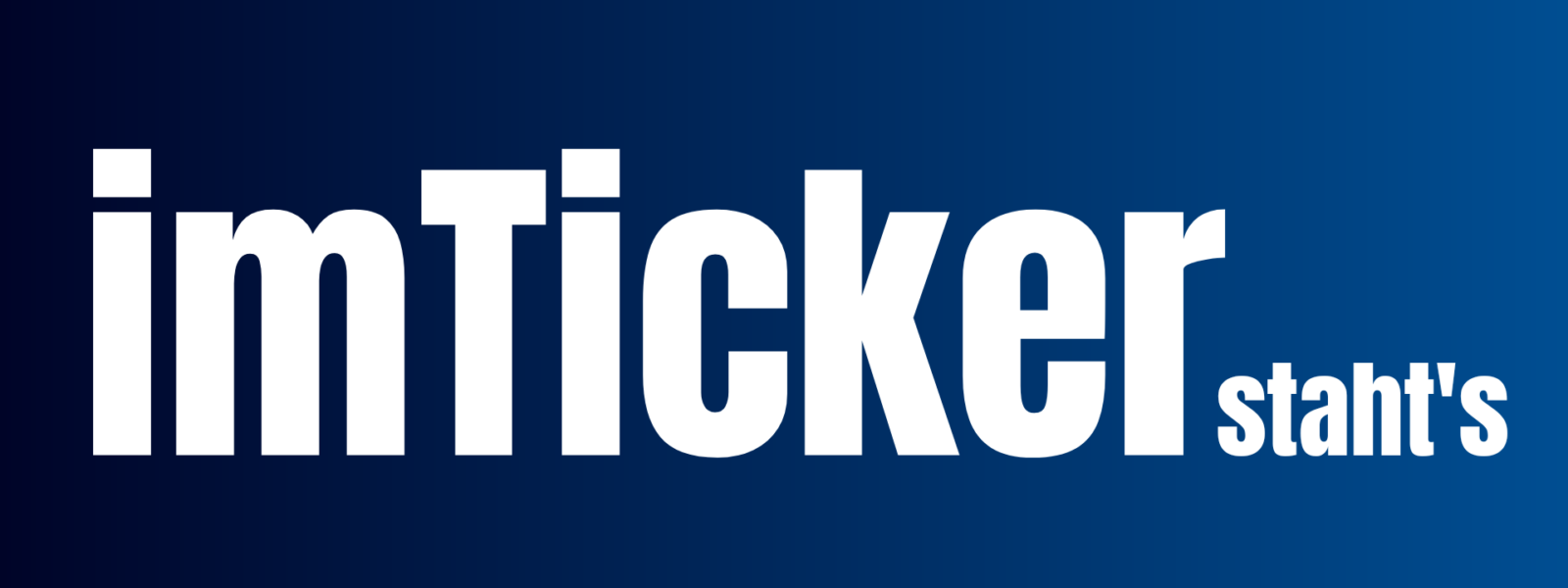Nordwestlagen treten seltener auf – das hat messbare Gründe
Sie galten lange als Klassiker im Schweizer Wettergeschehen: Nordwestlagen, bei denen feuchte und kühle Luft vom Atlantik gegen das Mittelland und die Voralpen strömt. Doch Wetterdienste registrieren seit Jahren einen Rückgang dieser Strömungssituation. Der folgende Bericht zeigt, wie häufig Nordwestlagen früher waren, warum sie heute seltener auftreten – und was dies für Klima, Natur und Bevölkerung bedeutet.
Als Nordwestlage bezeichnet man eine Grosswetterlage, bei der die Luftströmung über Mitteleuropa aus Nordwesten erfolgt. Typischerweise bringt sie feuchte Atlantikluft, Schauerwetter, Stau in den Voralpen und kühlere Temperaturen. Besonders im Frühling und Herbst spielte diese Wetterlage eine bedeutende Rolle für den Wasserhaushalt in der Schweiz.
Meteorologisch zählt die Nordwestlage zu den sogenannten Westwindwetterlagen, die historisch häufig für das typische „Aprilwetter“ verantwortlich waren. Während Südföhn oder Bisenlagen regional beschränkt wirken, betreffen Nordwestlagen oft die gesamte Alpennordseite – mit Auswirkungen auf Landwirtschaft, Schneereserven und Wetterstabilität.
Daten von MeteoSchweiz und dem Deutschen Wetterdienst (DWD) belegen, dass die Häufigkeit von Nordwestlagen in den letzten Jahrzehnten deutlich zurückgegangen ist. Grund dafür ist eine Verlagerung der dominanten Strömungszonen über dem Atlantik. Statt klassischer West- und Nordwestlagen treten häufiger sogenannte Blocking-Lagen auf – stationäre Hochdruckgebiete, die den Durchzug atlantischer Tiefdrucksysteme blockieren.
Ein Beispiel: Im Jahr 1980 wurde die Nordwestlage in der Schweiz an etwa 25 Tagen pro Jahr beobachtet. 2023 lag dieser Wert noch bei weniger als 10 Tagen. Stattdessen dominieren Südwestlagen, föhnige Nordströmungen oder stagnierende Hochs.
Diese Entwicklung steht in engem Zusammenhang mit veränderten Luftdruckmustern über dem Atlantik und der Arktis. Der sogenannte Jetstream, eine Höhenwindströmung, zeigt zunehmend wellenartige Ausprägungen und verlässt seltener seine West-Ost-Ausrichtung. Damit verringert sich die Wahrscheinlichkeit für regelmässige Nordwestlagen über Mitteleuropa.
Der Rückgang der Nordwestlagen hat messbare Auswirkungen:
-
Niederschlagsverteilung: Nordwestlagen waren wichtige Regenlieferanten für das Mittelland und die Voralpen. Ihr Rückgang führt zu längeren Trockenperioden und einer veränderten saisonalen Wasserbilanz.
-
Temperaturentwicklung: Weniger kühle Luftmassen aus Nordwesten bedeuten häufigere Wärmephasen, insbesondere im Frühling und Herbst.
-
Schneereserven: In vielen Jahren brachten Nordwestlagen entscheidende Schneefälle für tiefe Lagen und mittlere Höhen – diese fehlen zunehmend.
-
Stabilitätsverlust im Wettergeschehen: Blocking-Lagen führen häufiger zu Wetterextremen wie Hitzewellen oder Dauerregen, je nach Position des Hochdrucksystems.
Ein Monitoringprojekt der ETH Zürich zeigt, dass Nordwestlagen besonders in den Monaten März bis Mai deutlich seltener werden – mit Folgen für Landwirtschaft, Energieproduktion (Wasserkraft) und Biodiversität.
Für die Bevölkerung ist der Rückgang der Nordwestlagen oft indirekt spürbar – etwa durch ausbleibenden Landregen, weniger Wintereinbrüche oder ungewöhnlich stabile Hochdruckphasen. Bäuerinnen und Bauern berichten von trockeneren Böden im Frühling, Wintersportorte von zu wenig Schnee auf mittleren Lagen.
Auch die Abkühlung durch Westschauer fehlt zunehmend – was sich in steigenden Heiz- und Kühlkosten sowie veränderten Alltagsroutinen niederschlägt. Für Naturfreunde heisst es: Mehr Südwind, mehr Föhn, weniger „typisches Aprilwetter“.
Nordwestlagen waren einst prägende Elemente des Schweizer Wetters – heute sind sie eine Seltenheit. Die Ursachen sind meteorologisch nachvollziehbar und klimatisch erklärbar. Mit dem Rückgang dieser Strömungslage verändert sich nicht nur das Wetter, sondern auch die langfristige Planung für Landwirtschaft, Wasserwirtschaft und Energieversorgung. Die Schweiz wird trockener – und weniger atlantisch.
Verpasse keine News mehr! Aktiviere unseren kostenlosen Whatsapp-Kanal