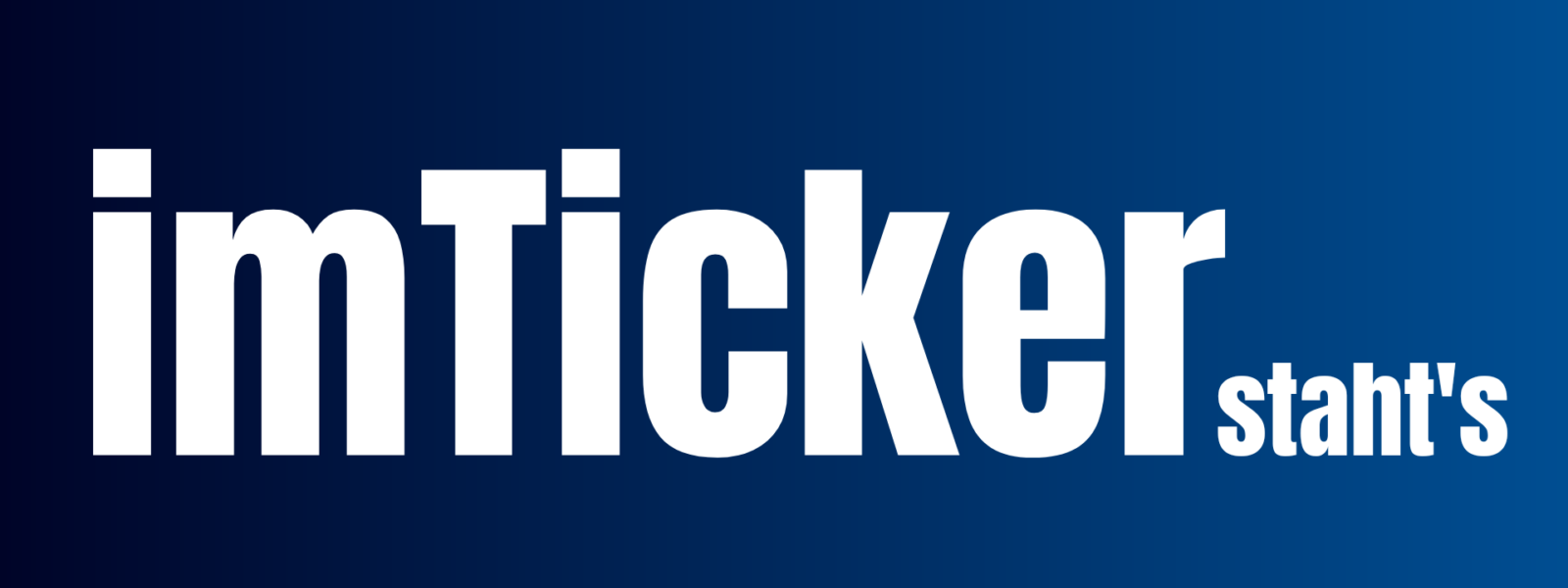Zwischen Erwartungsdruck und Nervenzusammenbruch – wie Schüler:innen, Eltern und Schulen das Selektionsverfahren erleben
Für viele Jugendliche ist sie die erste grosse Prüfung im Leben: die Aufnahmeprüfung für Gymnasium, Berufsmaturität oder Fachmittelschule. Wochenlang wird gelernt, gerechnet, geübt – begleitet von Schlafmangel, Leistungsdruck und Unsicherheit. Während sich Eltern fragen, ob der Weg der richtige ist, erleben Kinder eine emotional belastende Ausnahmesituation, die nicht selten Spuren hinterlässt. Der Beitrag zeigt, was Prüfungen leisten sollen – und was sie in der Realität auslösen.
Selektion mit System – und vielen Fragen
In vielen Schweizer Kantonen entscheiden Aufnahmeprüfungen über den Übertritt von der Sekundarstufe I ins Gymnasium oder in weiterführende Schulen. Ziel ist es, leistungshomogene Klassen zu schaffen und schulische Überforderung zu verhindern. Doch das Verfahren steht zunehmend in der Kritik: zu viel Druck, zu frühe Entscheidung, zu wenig Raum für Entwicklung.
Statistisch bestehen schweizweit je nach Kanton zwischen 30 und 50 % der Prüflinge den Übertritt ins Gymnasium. Die Vorbereitung beginnt oft mehrere Monate vorher – in Schulen, aber auch in privaten Vorbereitungskursen. Der Zugang zu solchen Angeboten ist nicht überall gleich – was Fragen zur Chancengleichheit aufwirft.
Was Kinder wirklich erleben – und was sie selten sagen
Viele Jugendliche berichten rückblickend, dass die Aufnahmeprüfung nicht nur eine Leistungs-, sondern vor allem eine Belastungsprobe war. Konzentration, Zeitmanagement, Selbstregulation – alles muss gleichzeitig funktionieren. Häufig kommt es zu Blockaden, Blackouts oder psychosomatischen Reaktionen. Vor allem bei Jugendlichen mit hohen Ansprüchen an sich selbst oder starkem familiären Druck kann der Prüfungsstress chronisch werden.
Ein weiterer Punkt: Die Prüfungssituation selbst ist oft ungewohnt – fremde Umgebung, unbekannte Aufsichtspersonen, absolute Stille. Fehler werden nicht erklärt, es gibt keine Rückmeldung, keine zweite Chance. Das Resultat entscheidet – über Schulweg, Zukunft, Selbstwertgefühl.
Lehrpersonen und Eltern im Spannungsfeld
Viele Lehrkräfte kritisieren die Aufnahmeprüfungen als zu stark leistungsorientiert, zu wenig entwicklungsorientiert. Immer wieder kommt es vor, dass Schüler:innen mit sehr guten Noten scheitern – oder solche mit mittelmässigem Zeugnis bestehen. Die Aussagekraft einzelner Prüfungstage bleibt umstritten.
Auch Eltern sind zunehmend verunsichert: Fördern oder überfordern? Kurs oder Vertrauen? Die Angst, dem eigenen Kind durch zu wenig Unterstützung eine Tür zu verschliessen, ist weit verbreitet – und führt oft zu einem komplexen Mix aus Erwartung und Überbehütung.
Die Aufnahmeprüfung bleibt ein zentrales Instrument der schulischen Selektion in der Schweiz – doch ihre Wirkung reicht weit über die Noten hinaus. Sie prägt Lebensläufe, Familienalltag und Bildungsbiografien. Wer sie erlebt, trägt meist nicht nur ein Resultat, sondern auch eine Erinnerung mit sich. Ob die Prüfung bleibt, sich verändert oder ersetzt wird – klar ist: Leistung misst man nicht nur in Punkten, sondern auch in Haltung, Motivation und Menschlichkeit.
Verpasse keine News mehr! Aktiviere unseren kostenlosen Whatsapp-Kanal