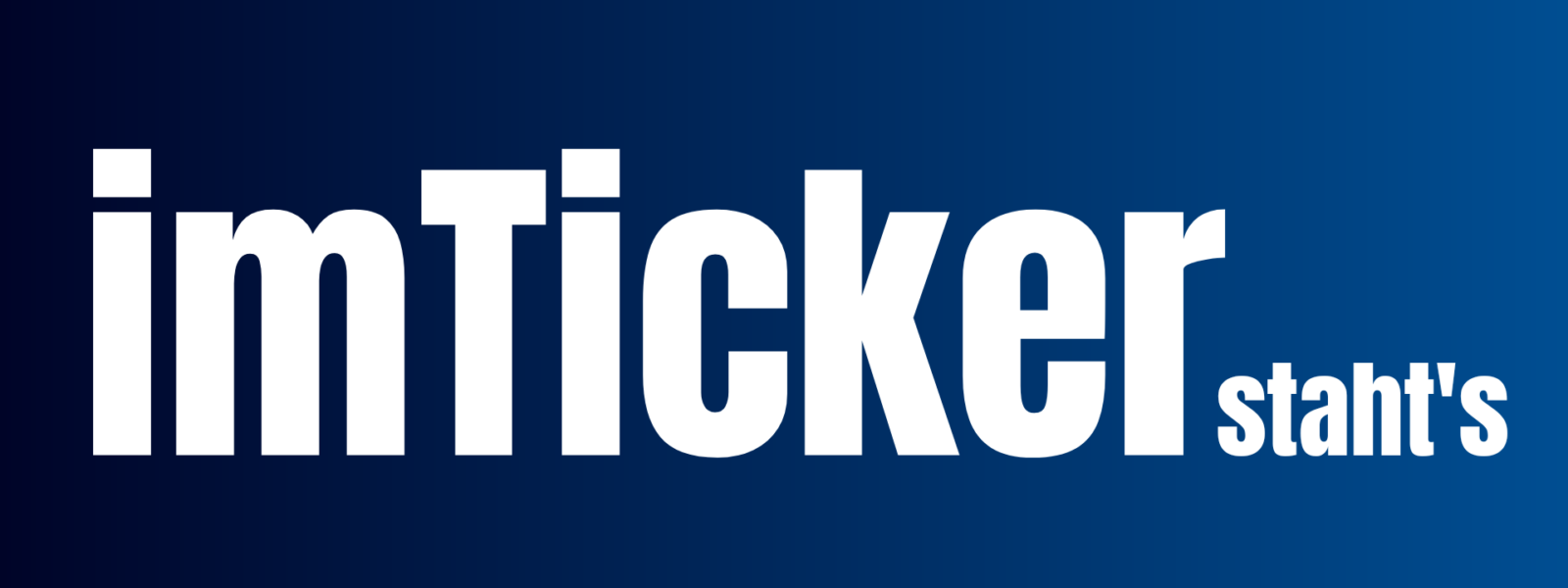In der Schweiz verschwinden immer mehr traditionelle Bräuche – mit spürbaren Folgen für Kultur und Identität.
Traditionelle Bräuche sind ein wichtiger Teil der Schweizer Identität – doch immer mehr davon geraten in Vergessenheit. Globalisierung, Urbanisierung und gesellschaftlicher Wandel tragen dazu bei, dass lokale Feste, Handwerke und Rituale zunehmend verschwinden. Experten und Kulturorganisationen schlagen Alarm: Der Verlust kultureller Vielfalt ist nicht nur ein emotionaler Verlust, sondern auch eine Gefahr für den sozialen Zusammenhalt.
Die Schweiz verfügt über eine aussergewöhnliche Vielfalt an Bräuchen, von regionalen Festen über Handwerkskunst bis zu religiösen Ritualen. In jeder Region haben sich über Jahrhunderte eigene Traditionen entwickelt – vom Alpabzug im Berner Oberland bis zur Silvesterchlausen im Appenzell (AR). Bräuche stiften Identität, fördern das Gemeinschaftsgefühl und stärken die Verbundenheit mit der Heimat. Doch seit der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts geraten viele dieser kulturellen Schätze unter Druck. Gründe dafür sind der Strukturwandel in der Landwirtschaft, der Einfluss der globalen Medien und veränderte Freizeitgewohnheiten.
Studien der Schweizerischen Gesellschaft für Volkskunde (SGV) zeigen, dass insbesondere kleinere, wenig bekannte Traditionen gefährdet sind. Während bekannte Ereignisse wie das Sechseläuten in Zürich oder die Basler Fasnacht weiterhin breite Unterstützung geniessen, sterben in ländlichen Gebieten lokale Feste oft aus, weil der Nachwuchs fehlt. In Graubünden etwa wird der Brauch des „Chalandamarz“, ein Frühlingsfest der romanischen Bevölkerung, nur noch in wenigen Dörfern im ursprünglichen Stil gepflegt. Kulturinstitutionen wie das Haus der Volkskulturen mahnen: „Ohne bewusste Pflege wird unsere kulturelle Vielfalt weiter schrumpfen“, warnt Direktorin Regula Steiner.
Laut einer Untersuchung des Bundesamts für Kultur (BAK) existieren in der Schweiz rund 1700 dokumentierte lebendige Traditionen – doch mindestens 30 Prozent davon gelten als akut gefährdet. Besonders betroffen sind handwerkliche Fertigkeiten wie das Spitzenklöppeln im Toggenburg (SG) oder das Korbflechten im Jura. Die UNESCO nahm bereits mehrere Schweizer Traditionen in die Liste des immateriellen Kulturerbes auf, darunter die Fête des Vignerons in Vevey (VD) und das Hornussen. Trotzdem reichen Schutzinitiativen oft nicht aus, wenn die gesellschaftliche Verankerung verloren geht.
Hans Keller aus dem Emmental (BE), der seit 40 Jahren an der Organisation eines traditionellen Erntedankfests beteiligt ist, sagt: „Früher kamen alle aus dem Dorf zusammen – heute bleibt die Hälfte der Bänke leer.“ Junge Menschen zieht es oft in die Städte, wo alte Bräuche keine Rolle mehr spielen. Auch Touristen berichten, dass authentische Feste immer seltener und durch Eventformate ersetzt werden. Der Wandel vollzieht sich langsam – und wird von vielen erst bemerkt, wenn die gelebte Tradition nicht mehr existiert.
Der Rückgang traditioneller Bräuche in der Schweiz ist ein stiller, aber folgenschwerer Prozess. Mit dem Verlust dieser kulturellen Wurzeln geht auch ein Stück der gesellschaftlichen Identität verloren. Wenn die Vielfalt an Traditionen bewahrt werden soll, braucht es gezielte Förderung, aktives Engagement der Gemeinschaften und ein neues Bewusstsein für die Bedeutung des kulturellen Erbes. Lesen Sie weiter, diskutieren Sie mit, teilen Sie diesen Artikel – denn unsere Bräuche sind ein Schatz, den es zu bewahren gilt.
Verpasse keine News mehr! Aktiviere unseren kostenlosen Whatsapp-Kanal