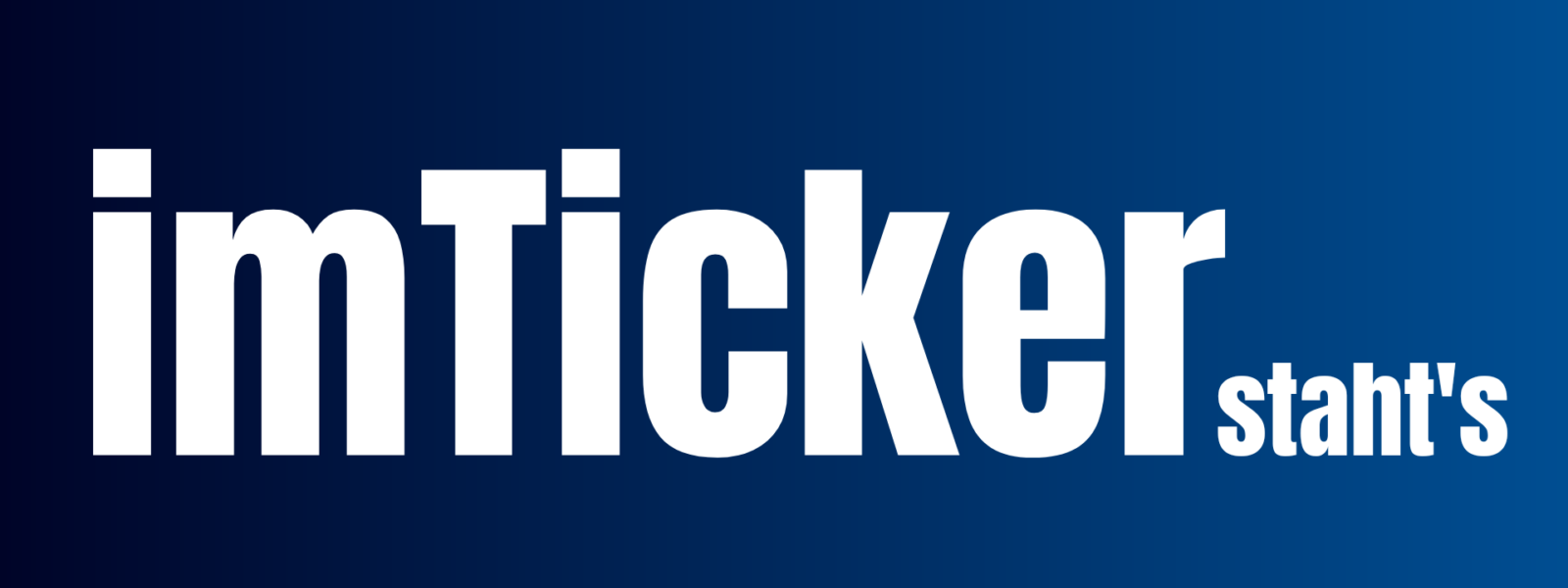Die Schweiz lagert strategische Vorräte im Milliardenwert – aus Angst vor Krisen, Katastrophen und Kriegen
Was passiert, wenn plötzlich die Lieferketten versagen? Wenn kein Mehl, kein Benzin und keine Medikamente mehr verfügbar sind? In der Schweiz soll das niemals Realität werden – dank eines einzigartigen Systems: den Pflichtlagern. Aktuell sind in unterirdischen Anlagen überlebenswichtige Güter im Wert von mehreren Milliarden Franken eingelagert. Hinter dieser Vorratshaltung steht nicht nur Tradition, sondern ein durchdachtes Sicherheitskonzept.
Doch warum hortet ein stabiles Land wie die Schweiz überhaupt solche Mengen? Und wie funktioniert das System konkret?
Seit dem Zweiten Weltkrieg verfolgt die Schweiz ein Konzept der sogenannten Pflichtlagerhaltung. Der Staat verpflichtet private Unternehmen, bestimmte Güter in festgelegter Menge zu lagern – und garantiert im Gegenzug die Kosten. Ziel: Die Versorgung der Bevölkerung in Krisenfällen sicherstellen.
Diese Pflichtlager umfassen u. a. Grundnahrungsmittel (Reis, Zucker, Speiseöl), Medikamente, Erdölprodukte, Saatgut und Tierfutter. Die Strategie wird vom Bundesamt für wirtschaftliche Landesversorgung (BWL) koordiniert. Ein vergleichbares System existiert in kaum einem anderen Land Europas.
2024 investierte die Schweiz laut BWL rund 2,4 Milliarden Franken in ihre Pflichtlager. Der Fokus liegt zunehmend auf medizinischer Versorgung und Energie: Medikamente, Treibstoff und Heizöl gelten seit der Pandemie und dem Ukraine-Krieg als besonders kritisch.
In mehr als 300 Lagern im ganzen Land – viele davon unterirdisch oder gut gesichert – liegen tonnenweise Waren bereit. Auch im Kanton Bern (BE), Zürich (ZH) und in der Zentralschweiz gibt es grosse Bunker. Der Bund veröffentlicht regelmässig Lagerkennzahlen und passt die Pflichtmengen je nach geopolitischer Lage an.
Nicht nur Konserven und Diesel: Auch Tierarzneien, Waschmittel und sogar gewisse Kunststoffprodukte zählen heute zu den Pflichtlagern. Das System wurde zuletzt 2022 grundlegend überprüft – mit dem Resultat, dass es effizient und überlebenswichtig sei.
Eine wissenschaftliche Studie der ETH Zürich von 2023 kommt zum Schluss: Die Schweizer Pflichtlager könnten im Krisenfall rund 4 bis 6 Monate Versorgungslücken überbrücken. Für viele Länder ein unrealistischer Luxus – für die Schweiz ein Teil der „vorausschauenden Neutralitätspolitik“.
Pflichtlager wirken aus der Zeit gefallen – und sind doch aktueller denn je. Die Schweiz beweist mit ihrem System, dass Vorbereitung keine Schwäche, sondern Stärke ist. Während andere Länder bei Versorgungsengpässen improvisieren, hat die Schweiz längst vorausgedacht.
Wie sich das Konzept künftig weiterentwickelt – etwa in Bezug auf Digitalisierung oder Klimakrisen – bleibt spannend.
Verpasse keine News mehr! Aktiviere unseren kostenlosen Whatsapp-Kanal