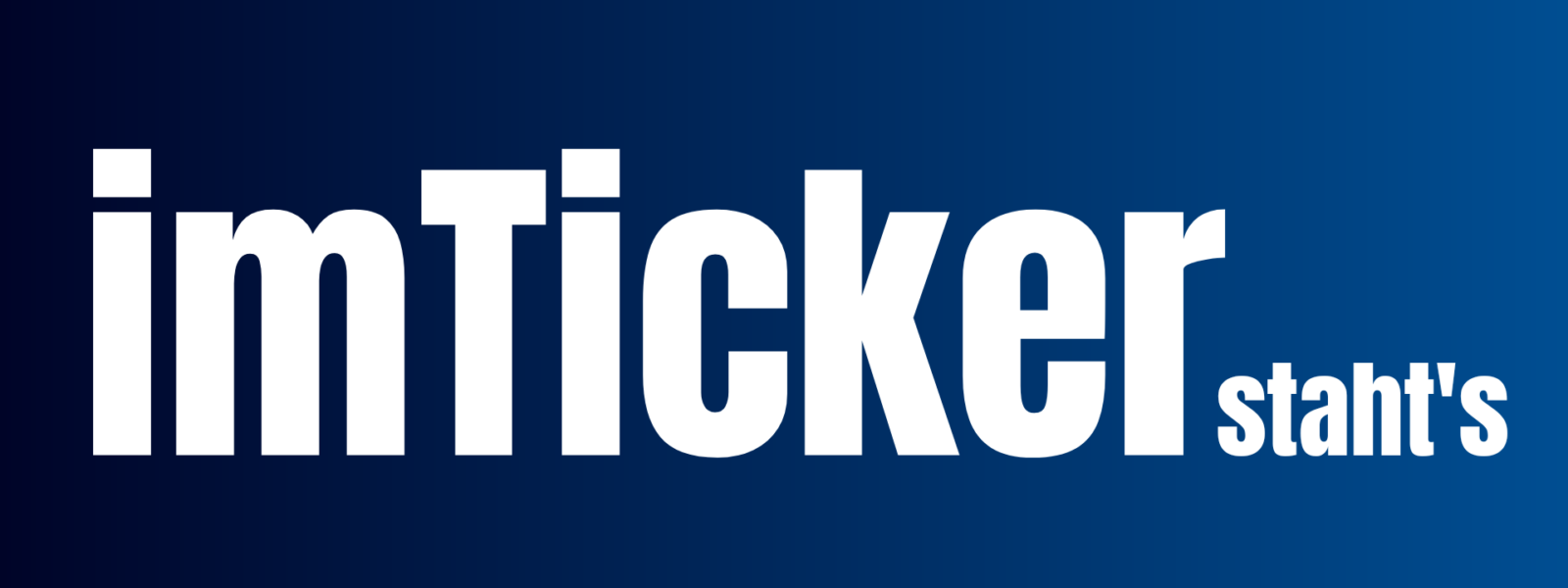Strassennamen prägen unser Stadtbild – doch wie sie entstehen, ist ein komplexer Prozess, mit Geschichte und Politik.
Strassennamen sind allgegenwärtig, aber selten hinterfragt. Dabei steckt hinter jeder Benennung ein Stück Geschichte, Politik – und manchmal auch Streit. Ob Helden der Vergangenheit, geografische Merkmale oder aktuelle Persönlichkeiten: Die Namenswahl ist nie zufällig.
In diesem Artikel zeigen wir, wer über Strassennamen entscheidet, welche Kriterien dabei gelten und warum die Wahl manchmal zu hitzigen Debatten führen kann. Ein Thema, das nicht nur Kommunalpolitik betrifft, sondern auch unser tägliches Leben.
Strassennamen dienen nicht nur der Orientierung – sie sind Ausdruck von Geschichte, Kultur und Zeitgeist. In Europa reicht die Tradition der Strassenbenennung bis in die Antike zurück. Während römische Städte bereits zentrale Achsen mit Namen versahen, wurde die flächendeckende Namensvergabe erst im 18. und 19. Jahrhundert üblich – im Zuge der Urbanisierung.
Heute sind Strassennamen fester Bestandteil der kommunalen Selbstverwaltung. In der Schweiz liegt die Zuständigkeit in der Regel bei den Gemeinden, in Deutschland bei den Städten und Gemeinden – meist auf Vorschlag von Kommissionen oder durch politische Gremien.
In Zürich (ZH) etwa entscheidet die Strassenbenennungskommission über neue Namen. Diese setzt sich aus Vertreterinnen und Vertretern der Stadtverwaltung, des Tiefbauamts, der Denkmalpflege und der Geschichtswissenschaft zusammen. In Basel (BS), Luzern (LU) oder Bern (BE) ist das Verfahren ähnlich geregelt.
Kontroversen gibt es immer wieder, etwa bei Umbenennungen historisch belasteter Namen. So wurde in Bern 2020 diskutiert, ob eine Strasse, die nach einem Kolonialverwalter benannt war, umbenannt werden sollte. In Deutschland sorgen ähnliche Debatten – z. B. um die Mohrenstrasse in Berlin – für öffentliche Aufmerksamkeit und gesellschaftliche Diskussion.
Laut einer Studie der Universität Zürich sind rund 85 % aller Strassennamen in Schweizer Städten nach Männern benannt – Frauen sind stark unterrepräsentiert. Das führte zur Forderung nach mehr weiblicher Repräsentation im öffentlichen Raum.
In ländlichen Gemeinden dominieren hingegen geografische Namen wie „Kirchweg“, „Feldstrasse“ oder „Bergliweg“. In neu geplanten Quartieren wiederum ist oft das Thema vorgegeben – etwa Pflanzen, Planeten oder lokale Persönlichkeiten.
Ein interessantes Detail: In der Schweiz dürfen Strassennamen nicht doppelt vergeben werden – auch nicht in verschiedenen Ortsteilen einer Gemeinde. Das verhindert Verwechslungen bei der Postzustellung oder bei Notfalleinsätzen.
„Ich finde es wichtig, dass auch Frauen und People of Color in unseren Strassennamen vorkommen“, sagt Sara M., Mitglied einer Zürcher Quartierorganisation. „Das schafft Sichtbarkeit – und reflektiert besser, wer wir heute sind.“
Auch Anwohner werden mit einbezogen: In vielen Gemeinden können sie bei der Benennung neuer Strassen Vorschläge einreichen. So entstehen manchmal kreative oder lokalpatriotische Namen – von „Chriesibühlweg“ bis „Turnerplatz“.
Strassennamen sind mehr als Adressen – sie sind Spiegelbild unserer Gesellschaft. Die Debatten um Umbenennungen und neue Namen zeigen: Hier geht es um Identität, Erinnerungskultur und politische Haltung.
In Zukunft dürfte die Beteiligung der Bevölkerung weiter steigen – ebenso wie der Anspruch, Namen inklusiver und vielfältiger zu gestalten.
Diskutieren Sie mit: Welche Strassennamen würden Sie sich in Ihrer Gemeinde wünschen?
Verpasse keine News mehr! Aktiviere unseren kostenlosen Whatsapp-Kanal